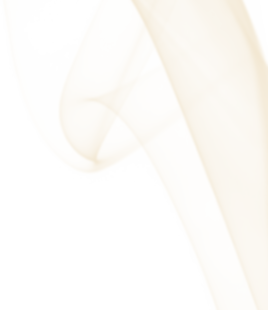In Deutschland ist die rechtliche Elternschaft eng mit der Geburt des Kindes verbunden. Die Geburtsmutter ist gemäß § 1591 BGB automatisch rechtliche Mutter. Für ihre Partnerin, unabhängig davon, ob es sich um eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft handelt, gibt es keine automatische rechtliche Elternstellung. Selbst wenn die Partnerin genetisch mit dem Kind verwandt ist (z. B. durch Eizellspende), wird sie rechtlich nicht als Mutter anerkannt.
Um die Elternschaft zu erlangen, muss die Partnerin der Geburtsmutter das Kind durch eine Stiefkindadoption adoptieren. Diese Möglichkeit steht gleichgeschlechtlichen Ehepaaren und Lebenspartnerinnen offen (§ 9 Abs. 7 LPartG bzw. nach § 1741 BGB). Durch die Adoption wird die Partnerin rechtlich gleichgestellt, einschließlich aller Rechte und Pflichten gegenüber dem Kind.
Eine automatische Mit-Elternschaft, wie sie bei heterosexuellen Ehepaaren durch die sogenannte „Vaterschaftsvermutung“ (§ 1592 BGB) besteht, gibt es für gleichgeschlechtliche Paare nicht. Die Rechtslage begründet sich darauf, dass der Gesetzgeber bislang keine Regelungen zur „Mit-Mutterschaft“ geschaffen hat, obwohl dies vielfach gefordert wurde.
Die Adoption durch die Partnerin der Geburtsmutter ist oft mit einem zeitlichen und bürokratischen Aufwand verbunden, was als Nachteil für gleichgeschlechtliche Paare gesehen wird. Diese Regelung wird zunehmend als diskriminierend kritisiert, da sie das Kindeswohl sowie die rechtliche Absicherung innerhalb der Familie potenziell beeinträchtigen kann.
Nach der Einführung der Ehe für alle (2017) hat der Gesetzgeber keine Anpassungen im Bereich der Elternschaft vorgenommen. Reformen, die eine automatische Mit-Elternschaft auch für gleichgeschlechtliche Ehepaare vorsehen, sind in Diskussion, jedoch bisher nicht umgesetzt.
In der Praxis bedeutet dies, dass gleichgeschlechtliche Partnerinnen einer Geburtsmutter auf die Adoption angewiesen bleiben, um die volle rechtliche Elternschaft zu erlangen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) urteilte nun im Fall R.F. und andere gegen Deutschland, dass die deutschen Regelungen zur rechtlichen Elternschaft bei gleichgeschlechtlichen Paaren mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sind. Das Gericht wies die Beschwerde eines Paares ab, das die automatische Anerkennung der genetischen Mutter als rechtliche Eltern forderte, ohne eine Adoption durchlaufen zu müssen. Der Fall betraf ein Kind, das durch eine künstliche Befruchtung in Belgien gezeugt wurde, wobei die Partnerin der Geburtsmutter die Eizellspenderin war.
Der EGMR argumentierte, dass die deutschen Regelungen die familiäre Bindung des Kindes nicht beeinträchtigen, da die Partnerin durch Adoption die rechtliche Elternschaft erreichen kann. Der Staat habe mit dieser Regelung einen angemessenen Ausgleich zwischen seinen rechtlichen Vorgaben und den Interessen der betroffenen Familie geschaffen. Das Gericht erkannte auch an, dass es keinen europaweiten Konsens zu dieser Frage gibt und den Staaten ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht.
Dieses Urteil ist für Leser interessant, da es die aktuelle Rechtslage bestätigt und zeigt, dass die deutsche Regelung als menschenrechtskonform gilt. Für betroffene Paare bedeutet dies jedoch, dass weiterhin die Adoption notwendig ist, um die volle rechtliche Elternschaft zu sichern.
Gericht: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Aktenzeichen: 46808/16
Datum: 12. November 2024