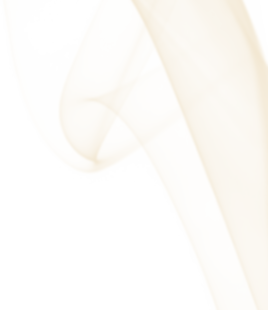Was bedeutet „elterliche Sorge“?
Die elterliche Sorge umfasst das umfassende Recht und die Pflicht der Eltern, für ihr minderjähriges Kind zu sorgen. Sie betrifft nicht nur Entscheidungen des Alltags, sondern auch grundlegende Fragen zur Entwicklung, Gesundheit, Erziehung, Ausbildung und Vermögenssituation des Kindes.
Rechtlich geregelt ist die elterliche Sorge in den §§ 1626 ff. BGB. Die Vorschriften sehen vor, dass Eltern gemeinsam für das Kind verantwortlich sind und alle Entscheidungen nach dem Kindeswohl auszurichten haben.
Die elterliche Sorge gliedert sich in mehrere Teilbereiche, darunter insbesondere:
- Personensorge (z. B. Pflege, Erziehung, Aufenthaltsbestimmung, Gesundheit, schulische Belange),
- Vermögenssorge (z. B. Verwaltung von Sparvermögen, Verträge, Haftung),
- sowie das Recht zur Vertretung des Kindes in rechtlichen Angelegenheiten.
Wer hat das Sorgerecht?
Sind die Eltern eines Kindes miteinander verheiratet, steht ihnen das Sorgerecht grundsätzlich gemeinsam zu.
Sind die Eltern nicht verheiratet, so hat zunächst die Mutter allein das Sorgerecht. Die Eltern können jedoch durch Sorgeerklärungen beim Jugendamt oder durch eine gerichtliche Entscheidung die gemeinsame Sorge begründen (§ 1626a BGB).
Seit einer Reform des Familienrechts im Jahr 2013 kann auch ein Vater, dem die Mutter die gemeinsame Sorge verweigert, beim Familiengericht beantragen, ihm das gemeinsame Sorgerecht zuzusprechen – wenn dem keine kindeswohlbezogenen Gründe entgegenstehen.
Was bedeutet „gemeinsame“ oder „alleinige“ elterliche Sorge?
In der Praxis kommt es häufig vor, dass Eltern getrennt leben oder sich scheiden lassen. Die Trennung ändert grundsätzlich nichts am gemeinsamen Sorgerecht. Die Eltern müssen weiterhin gemeinsam alle wesentlichen Entscheidungen treffen – etwa zur Schulwahl, medizinischen Behandlungen oder einem Wohnortwechsel des Kindes.
Kommt es hier zu Meinungsverschiedenheiten, kann ein Elternteil beim Familiengericht beantragen, bestimmte Entscheidungsbefugnisse allein zu übertragen, etwa:
- das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht,
- oder im Ausnahmefall auch die alleinige elterliche Sorge insgesamt.
Letzteres ist jedoch nur möglich, wenn die gemeinsame Ausübung der elterlichen Sorge nicht funktioniert und das Kindeswohl beeinträchtigt ist (§ 1671 BGB).
Beispiel aus der Praxis
Beispiel:
Nach der Trennung beantragt die Mutter die alleinige elterliche Sorge, weil es mit dem Vater immer wieder zu erheblichen Konflikten über schulische und gesundheitliche Fragen des Kindes kommt.
Das Familiengericht prüft, ob die gemeinsame Sorge dem Kind noch dienlich ist. Falls nicht, kann es der Mutter das alleinige Sorgerecht übertragen.
Unterschied zur Alltagssorge
Zu unterscheiden ist die elterliche Sorge von der sogenannten Alltagssorge. Diese umfasst alltägliche Entscheidungen wie z. B. was das Kind anzieht, wann es ins Bett geht oder welche Freizeitaktivitäten es wahrnimmt. Im Alltag trifft der Elternteil, bei dem das Kind lebt, diese Entscheidungen allein, auch bei gemeinsamem Sorgerecht.
Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. 👉 Kontakt
« zurück zum Index